ICE 1 (Baureihe 401) – Intercity-Express Hochgeschwindigkeitszug
ICE 1 auf dem Gelände des ICE-Betriebswerks in Hamburg-Eidelstedt – 26.07.1995 © Andre Werske
Der ICE 1 im Überblick
Am 2. Juni 1991 begann in Deutschland das ICE-Zeitalter. 23 ICE-Züge der Baureihe 401 beförderten die Fahrgäste auf der Relation Hamburg – Frankfurt – Stuttgart – München mit bis zu 250 km/h, die sie auf den beiden ersten Schnellfahrstrecken der Bundesrepublik erreichten. Mit den Jahren wuchs die ICE-1-Flotte auf 60 zwölfteilige Hochgeschwindigkeitszüge an, die ab 1995 in der Spitze 280 km/h schafften. Das ICE-Netz dehnte sich in ganz Deutschland aus; auch gab es Verbindungen mit ICE-1-Zügen nach Österreich und in die Schweiz. Bei einem schweren Zugunglück am 3. Juni 1998 zerschellte ein Zug dieser Baureihe nach einer Entgleisung an einer Brücke. Dank zweier Modernisierungsprogramme wird die Baureihe 401 größtenteils bis 2030 im Einsatz bleiben.
Wie kam es zum Entscheid für einen Serien-ICE?
Die Eisenbahn in Europa sah sich ab den Fünfzigerjahren einem stetig schärfer werdenden Wettbewerb gegenüber dem Auto und dem Flugzeug ausgesetzt. „Um sich an die wandelnden Bedingungen des Verkehrsmarktes und der Gesellschaft anzupassen, müssen sich die europäischen Bahnen […] zu modernen Dienstleistungsunternehmen entwickeln“[1] „Der Bau neuer Strecken für Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h und die Realisierung einer neuen Fahrzeuggeneration“ waren notwendig, um die Zukunft der Bahn zu sichern.[2] Mit dem Serien-ICE der ersten Generation sowie den Schnellfahrstrecken Hannover – Würzburg und Mannheim – Stuttgart startete die Deutsche Bundesbahn das „Unternehmen Zukunft“.[3]
Herstellung des ICE 1
Schon 1984 begannen die vorbereitenden Arbeiten für die Serien-ICEs.[4] Doch noch standen die Erfahrungen aus den Versuchsfahrten mit dem InterCityExperimental aus, die in die Serienfertigung des ICE der ersten Generation einfließen sollten. Bereits drei Jahre nach Erscheinen des ICE-Versuchszuges (ICE-V) vergab die Deutsche Bahn im Sommer/Herbst 1988 den Auftrag zum Bau von 82 Serientriebköpfen. Die Kastenrohlinge entstanden bei Krauss-Maffei in München. Danach führten Krauss-Maffei, Krupp Maschinentechnik, Thyssen-Henschel, Siemens und andere den weiteren Ausbau der Triebköpfe fort.[5] Am 26. September 1989 hatte der erste Serientriebkopf bei Krauss-Maffei in München unter Prominenz seinen ersten „roll-out“. Im Ausbesserungswerk in Opladen wurden ab Oktober des gleichen Jahres die Triebköpfe mit der Feinausrüstung komplettiert und auf Herz und Nieren geprüft.[6][7] Für die Mittelwagen war hauptsächlich Linke-Hofmann-Busch in Salzgitter verantwortlich. Beteiligt waren aber auch die Waggon-Union in Berlin, DUEWAG AG in Krefeld und MBB-Verkehrstechnik in Donauwörth. Die ersten Vorbereitungen traf man bereits Mitte 1988, bis zum Baubeginn sollte jedoch noch ein weiteres Jahr verstreichen.[5] Erst im Juli 1990 konnte der erste von 492 Serien-Mittelwagen in Betrieb genommen werden.[6] Die Speisewagen wurden zuletzt hergestellt.[7] Schon vor der Premiere stand fest, dass weitere ICE-Garnituren vonnöten seien, um auch die Schweiz an das ICE-Netz anzubinden. Am 23.07.1990 gab es grünes Licht zum Bau von weiteren 19 Zügen der ersten Generation.[8]
ICE-1-Testfahrten
Die ersten Rollversuche fanden ab Ende Juni 1990 statt. Da anfangs die Mittelwagen noch nicht für Belastungstests zur Verfügung standen, wurden stattdessen ausgediente Schnellzugwagen umgerüstet und zwischen die beiden Triebköpfe gespannt. Rund um Opladen drehten diese „Dummyzüge“ ihre Runden.[7] Bei den ersten Schnellfahrversuchen auf Neubaustrecken-Abschnitten wurden die Triebköpfe Rücken an Rücken gekuppelt, wobei eine provisorische 15 kV Starkstromleitung die beiden Maschinen verband. Dadurch musste nur ein Stromabnehmer am Fahrdraht anliegen. Als Bremslok nahm die DB eine getriebetechnisch umgerüstete Baureihe 103.222, die man für 280 km/h zuließ und in 750.003 umbenannte. Zwischen der Bremslok und den beiden ICE-Triebköpfen reihten sich bis zu drei Messwagen ein. Am 26. Juni 1990 erreichte solch eine Zugkomposition auf dem Neubaustreckenabschnitt Würzburg – Fulda knapp 280 km/h.[9] Ein paar Monate später gingen die ersten 13-teiligen Kompositionen zu Abnahmefahrten auf die Strecke. Für die Zulassung im alltäglichen Betrieb musste jeder Zug 10 Prozent schneller fahren, als er technisch eigentlich zugelassen war. Im Falle des ICE 1 bedeutete es, dass er mindestens 308 km/h zu erreichen hatte.[8]
ICE 1 im Plandienst: 1991-1993
ICE-Linie 6
Am 29. Mai 1991 fand bereits eine Sternfahrt mit Ehrengästen in fünf ICE-Zügen zum neuen Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe statt. Nicht nur der Bahnhof, sondern auch die beiden Neubaustrecken sowie die ICE-Züge wurden an jenem Tag offiziell eingeweiht.[10] Doch das ICE-Zeitalter im Fahrplanbetrieb begann am 2. Juni 1991. Mit bis dato 25 ausgelieferten und 23 einsatzfähigen Zügen war nur die Bildung einer ICE-Linie möglich.[11][12] (andere Quelle: „Mit 18 Zügen wurde [der Betrieb] aufgenommen“[13]) Um so viele Neubaustrecken wie möglich zu nutzen, entschied sich die Deutsche Bahn, die ICE-Züge auf der neuen ICE-Linie 6 einzusetzen. Die Streckenführung ging von Hamburg nach München über Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda, Frankfurt am Main, Mannheim, Stuttgart, Ulm und Augsburg. Dort, wo der ICE die Schnellstrecken bediente, reduzierte sich die Fahrzeit drastisch. Reisende von Hannover nach Frankfurt benötigten mit dem IC zuvor noch 3 Stunden 19 Minuten. Mit dem ICE sparte man eine knappe Stunde. Zwischen Mannheim und Stuttgart reduzierte sich die Reisezeit von 77 auf 40 Minuten. Von Hamburg nach Stuttgart ging es von nun an knapp zwei Stunden schneller. Zwischen Kassel und Augsburg sparte man 55 Minuten ein. Auf manch anderen Relationen fiel das Ergebnis weniger deutlich aus. Zwischen Frankfurt und München reduzierte sich die Fahrtzeit nur um 12 Minuten. Die gesamte Strecke von Hamburg nach München dauerte immerhin noch 6 Stunden. Der ICE war nur 40 Minuten schneller als lokbespannte Züge, die über Würzburg geführt wurden.[3][12]
„Kinderkrankheiten“
Trotz einer vorangegangenen längeren Testphase, in der ICE-Garnituren zwischen Hamburg und München unterwegs waren, ließen sich sogenannte Kinderkrankheiten nicht ganz vermeiden. Den Fahrgästen fielen verstopfte Toiletten und blockierte Einstiegstüren auf. An heißen Tagen gab es Probleme mit der Steuerungselektronik.[14] Die Klimaanlagen hielten dagegen durch. Schwierigkeiten mit dem Antrieb führten zu Nachbesserungen seitens der Industrie.[14][15] Doch „[i]n Wirklichkeit hatte die DB eine Meisterleistung vollbracht. Einige Zuggarnituren waren praktisch direkt vom Fließband in Betrieb genommen worden, und es war eigentlich erstaunlich, daß keine ernsthafteren Probleme auftraten“[15]
ICE-Linien 3 und 4, Anbindung an Berlin, Shuttle-ICE und Sprinterzüge
Nach und nach wurde im laufenden Fahrplan 1991/92 die IC-Linie von Hamburg nach München via Würzburg auf ICE-Betrieb umgestellt[16] – aber nur mit einer Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h. Erst zum Fahrplanwechsel 1992 waren alle lokbespannten Züge auf der ICE-Linie 4 durch ICE-Garnituren ersetzt worden, womit die Höchstgeschwindigkeit auf 250 km/h angehoben werden konnte.[12] Als die DB merkte, dass es auf der Linie 6 zu wenig Zweitklass-Sitzplätze gab, wurden 15-teilige Garnituren (13 Mittelwagen) mit einem zusätzlichen Wagen zweiter Klasse gebildet. Die 13-teiligen ICE mit 11 Mittelwagen setzte die DB auf der Linie 4 ein. Erst 1993 hatten alle ICE wieder 12 Mittelwagen.[49] Ebenfalls 1992 schuf die DB den „Shuttle-ICE“, der am frühen Morgen zwischen München und Frankfurt nur in Mannheim einen Zwischenhalt einlegte. Damit konnten 30 Minuten Fahrzeit eingespart werden. Hinzu kamen Sprinter-Züge zwischen Hamburg und Frankfurt, die 20 Minuten schneller waren als andere ICE-Züge auf dieser Relation.[14] Offenbar gab es in der Anfangszeit des ICE speziell für Lufthansa-Fluggäste eingerichtete Zugverbindungen zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart. Ende 1993 wurden diese jedoch eingestellt, was aber später von den Fluggästen kritisiert wurde.[17]
Im Oktober 1992 besuchte die britische Königin Elisabeth II Deutschland. Für die Reise stellte man ihr einen ICE zur Verfügung – mit zwei Bordrestaurantwagen![49] Für den Besuch des japanischen Kaisers Akihito mit seiner Frau im September 1993 machte man weniger „Gedöns“. Nur ein Wagen wurde für die beiden vorbereitet, indem die Sitze entfernt und durch ein Ledersofa ersetzt wurden.[18]
Mit der Ablieferung der 19 nachbestellten Schweiz-tauglichen ICE-Garnituren war ab Winter 1992/93 auch die Bildung der ICE-Linie 3 von Hamburg nach Karlsruhe mit teilweiser Verlängerung nach Basel und Zürich möglich.[16] Diese Garnituren waren auf 10 Mittelwagen verkürzt.[19] Im Mai 1993 wurde Berlin ans ICE-Netz angebunden[14] (andere Quelle: 3. Juli 1993[18]).
Das heutige ICE-Streckennetz
Bistrobrummen
Der ICE war vom Start an bei den Fahrgästen sehr beliebt – nicht nur wegen der kürzeren Reisezeiten, sondern auch wegen des hohen Komforts.[15] Allerdings ließ die Fahrqualität der ICE-1-Züge im Vergleich zu anderen Hochgeschwindigkeitszügen sehr zu wünschen übrig: „Die Laufruhe der Shinkansen 500 bei 300 km/h ist sehr beeindruckend. Im Vergleich dazu empfindet der Berichterstatter den ICE 1 subjektiv als eine sich periodisch aufschaukelnde ‚Rüttelkiste‘“[20] Beim InterCityExperimental wurden sowohl luftgefederte Drehgestelle getestet als auch Fahrwerke mit Stahlfederung. Man entschied sich, stahlgefederte Drehgestelle der Bauform MD 530 für alle ICE-1-Mittelwagen zu verwenden.[21] „Für weitere Serien wird das luftgefederte Drehgestell, wie es z. B. im Vorläuferfahrzeug eingebaut ist, anwendungsreif entwickelt werden“[22] Die Luftfederung war für den ICE 1 offenbar noch nicht für hohe Geschwindigkeiten fertig entwickelt worden und sollte erst im ICE der Baureihe 402 Anwendung finden. Besonders nervig war für die Fahrgäste und die DB das Klappern des Geschirrs im Bordrestaurant. „In einem Feldversuch hatte die DB […] vier ICE-Bordrestaurantwagen mit speziellen Radsätzen ausgerüstet. Sie haben zwischen dem Radkörper und der Lauffläche einen massiven, radumspannenden Gummiring. Er wirkt offenbar dämpfend auf die Eigenschwingung des Rades und damit des ganzen Wagenkastens und somit letztlich vibrationshemmend auf die Fahrgastzelle“[23] Dieser Radtyp kam bis dato nur bei Straßenbahnen zum Einsatz. Die DB ließ ihn für den Hochgeschwindigkeitsverkehr optimieren und verwendete ihn für ihre ganze ICE-1-Flotte.[24]
Drehgestellversuche in ICE-1-Zügen
Da die Drehgestelle mit Luftfederung noch nicht fertig entwickelt waren, als die Serienproduktion der ersten ICE-Generation startete, wurden auch mit ICEs, die im Fahrgastbetrieb waren, neue Drehgestell-Varianten erprobt. Im Sommer 1993 gab es erfolgreiche Tests auf dem Rollprüfstand bis 400 km/h sowie Messfahrten bis 330 km/h. Was fehlte, waren Langzeitversuche. Das luftgefederte Drehgestell von SIG wurde am Mittelwagen 801.088 zwei Jahre lang auf Herz und Nieren getestet. MAN entwickelte das Hochleistungsfahrwerk HLD 500 aus Faserverbundstoffen, das im Mittelwagen 802.860 verbaut wurde. Weitere 5 Laufwerke unterschiedlicher Hersteller und Bauformen gingen 1993 in die Dauererprobung.[25]
Ursprüngliche Inneneinrichtung im ICE 1
Was den ICE damals zu einem ICE machte, war nicht nur an der hohen Geschwindigkeit festzumachen. Die drei Buchstaben standen für maximalen Komfort, der in Hochgeschwindigkeitszügen anderer Bahngesellschaften zu jener Zeit spürbar magerer ausfiel. „Im Vergleich mit diesem prunkvollen Palast auf Rädern wirkten der französische und der japanische Hochgeschwindigkeitszug eindeutig als auf pure Nützlichkeit ausgerichtet“[26] Ein Gang durch den Zug in seiner ursprünglichen Konfiguration soll die damaligen Annehmlichkeiten für den Reisenden hervorheben.
ICE 1 in der 2. Klasse
Nach dem Triebkopf folgten bis zu 7 Mittelwagen der zweiten Klasse. In jedem befanden sich sowohl 4 geschlossene Abteile mit 6 Sitzplätzen als auch ein Großraumbereich mit 2 x 2 Reihen- und Vis-à-vis-Bestuhlung.[27] In den Großräumen mit Reihenbestuhlung waren die meisten Sitze drehbar. Das Ausrichten in Fahrtrichtung sollte das Bordpersonal übernehmen.[12][27] Die Rückenlehne ließ sich um bis zu 40 Grad neigen und die Sitzfläche stufenlos verstellen.[12] Des Weiteren waren in den Armlehnen der Abteil- und Reihensitze schwenkbare Tische und Aschenbecher eingelassen. Unter den Lehnen wurden Abfallbehälter montiert. Leseleuchten über jedem Sitzplatz boten optimale Lichtverhältnisse. Audiomodule in einem der beiden Armlehnen ermöglichten den Empfang von 3 Rundfunksendern und 3 Bordprogrammen.[3] Dazu war lediglich ein Kopfhörer mit einem 3,5 Millimeter Klinkenstecker notwendig, der von Zuhause mitgebracht oder im Zug günstig erworben werden konnte. Im anfangs ersten, später dritten Zweitklasswagen waren Flachbildschirme in den Rückenlehnen einmontiert, die während der Fahrt über zwei Videokanäle Filme zur Unterhaltung zeigten. In zwei ICE-1-Zügen wurden in den Führerständen Videokameras installiert. Fahrgäste konnten, wenn sie an einem Videositzplatz saßen, die Fahrt aus der Sicht des Lokführers erleben. Die Anlagen wurden jedoch nach nur wenigen Jahren wieder demontiert.[28]
Es gab reichlich Platz fürs Gepäck: auf seitlichen, über den Sitzen angebrachten Gepäckablagen sowie zwischen den Rücken an Rücken angeordneten Sitzen. Optisch fielen im Großraum die beiden Garderoben auf, wo auch sperriges Gepäck abgestellt werden konnte. In jedem zweiten Wagen war es den Fahrgästen möglich, ihr Handgepäck in Schließfächern zu deponieren.[27] Die Wagen waren mit Teppich ausgelegt. Im Winter machte sich im ICE wohlige Wärme breit. Im Heizbetrieb wurde die Temperaturverteilung durch die Fußbodenheizung zusätzlich verbessert. Eine elektrische Zusatzheizung in der Außenwand des Zuges ließ angenehm temperierte Luft an der Unterkante der Fenster austreten.[12] Neu war auch die hervorragende Klimaanlage. Frischluft strömte über die Gepäckablagen in den Fahrgastraum. Knapp über dem Boden wurde die verbrauchte Luft wieder abgesaugt. Die Klimaanlage war nicht nur zugfrei, sondern auch gegen Druckschwankungen bei Tunneleinfahrten oder Zugbegegnungen geschützt. Zwei wie Einschusslöcher aussehende Sensoren an jeder Wagenaußenseite maßen den Außendruck. Schwankte dieser zu stark, verschloss die Klimaanlage die Luftzufuhr.[29]
Neben den Eingangstüren gaben Informationsdisplays Hinweise zum Zug und zum nächsten Halt. Ab und an wurde auch die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Glasschiebetüren, die sich durch Lichtsensoren automatisch öffneten, trennten den Fahrgastraum vom Einstiegsbereich ab. Der Wechsel zum nächsten Wagen führte durch den druckdichten Balg. Ohne Jakobsdrehgestelle passte man selbst mit sperrigem Gepäck mühelos hindurch.[12]
Servicewagen des ICE 1
Nach den Zweitklasswagen schloss sich der Servicewagen 803 an. Hier fanden nur 39 Reisende einen Sitzplatz zweiter Klasse. Danach waren Stellplätze für zwei Rollstühle vorhanden. Es folgten Sonderabteile wie das Konferenzabteil mit großem Tisch, vier Sesseln, einem Ablagebord, Faxgerät, Kopierer und Telefon. Dieses musste vor der Fahrt angemietet werden. Das nächste Abteil diente dem Zugführer. Es beinhaltete Geräte für das Fahrgastinformationssystem sowie der Video- und Audioeinspeisung. Jeder ICE konnte angerufen werden. Ein Anrufbeantworter nahm die Gespräche für die Fahrgäste entgegen. Eine Telefonzelle, eine Toilette für das Zugpersonal und ein rollstuhlgerechtes WC mit Wickelbrett schlossen sich an. Am Gang befand sich zudem ein BTX-Terminal. Von hier aus waren beispielsweise Hotelbuchungen möglich.[12]
Der ICE-1-Speisewagen
Die eine Hälfte des Wagens mit der Baureihennummer 804 bestand aus einem Bordtreff mit Bistro. 16 Sitz- und etwa 10 Stehplätze an Tischen standen in diesem Raucherbereich zur Verfügung. Ab dem 1. Oktober 2006 wurde daraus ein Nichtraucher-Bereich.[30] Neben Bier und alkoholfreien Getränken bekam man an der Theke kleinere Snacks und Zeitungen. Über einen Seitengang, der an einer vollwertigen Küche vorbeiführte, erreichte man den Restaurantbereich. 24 Sitzplätze auf Polsterbänken und Stühlen luden zum Mittagessen ein. Hier wurde man am Platz bedient. Die vielfältigen, qualitativ hochwertigen Speisen passten zum angenehmen Ambiente, welches die Holzvertäfelungen, der Licht durchflutete Dachbereich und die indirekte Beleuchtung verbreiteten. Ein- und Ausgänge bot der Speisewagen nicht, dafür aber an beiden Seiten eine Ladetüre für das Küchenpersonal. Die Deutsche Bundesbahn wollte den Speisewagen eigentlich abschaffen. Dafür war ab dem 1. Juli 1993 das Bordrestaurant auf der Linie 3 geschlossen worden. Ein Bord-Treff mit Selbstbedienung und ein „Am-Platz-Service“ hätten genügen sollen. Wegen fehlendem Anklang bei den Reisenden blieben die Buckelspeisewagen glücklicherweise vollwertige Restaurantwagen.[31]
ICE 1 in der 1. Klasse
Auch in diesen Wagen der Baureihennummer 801 wurden sowohl Abteile als auch Großraumbereiche angeboten. Im Vergleich zur zweiten Klasse fand man hier nur drei Abteile mit jeweils 5 Sitzplätzen. Der Großraumabschnitt enthielt Sitze, die in Reihe angeordnet und größtenteils in Fahrtrichtung drehbar waren, sowie Vis-à-vis-Plätze mit Tischen in der Mitte. Eine Garderobe war ebenfalls vorhanden. Um eine Qualitätssteigerung zur zweiten Klasse zu bieten, waren alle Metallteile nicht verchromt, sondern in Goldtönen gehalten. Jeder Sitz hatte seine eigene, breite Armlehne. Bei den Reihensitzen war, wie in der zweiten Klasse, jeweils ein schwenkbarer Klapptisch unter der Armlehne herausziehbar. Schließfächer für Handgepäck und ein WC rundeten das Angebot ab. Spezielle Knöpfe ermöglichten den Ruf des Zugbegleiters für den „Am-Platz-Service“. Einer von den üblicherweise vier Erstklasswagen war Rauchern vorbehalten. Der letzte Wagen vor dem Triebkopf bot Videositzplätze à la zweite Klasse an. Wie überaus großzügig die Fahrgäste Platz hatten, wird im Vergleich mit den Eurostar-Hochgeschwindigkeitszügen deutlich, die 1994 in Betrieb gingen: Im Eurostar sitzt man „weit enger als in den 21 cm breiteren deutschen ICE-Zügen. In der ersten Klasse ist der Eurostar zwar deutlich komfortabler, erreicht aber auch nicht die Sitzbreite und die Beinfreiheit des entsprechenden Großraums im Deutschen ICE“[32] Der ICE 1 war kein Leichtgewicht. So luxuriös und komfortabel die Inneneinrichtung auch sein mochte, für einen Hochgeschwindigkeitszug waren die einzelnen Komponenten zu schwer. Das betraf vor allem die Sitze; aber auch echter Marmor hatte im Bordtreff nichts zu suchen. Zudem wurde viel Glas verbaut. Deswegen übernahm die DB in den nachfolgenden ICE-Generationen nicht die gleiche Ausstattung wie im ICE 1.[33][34]
Die ursprüngliche Technik des ICE 1
ICE-1-Triebköpfe
Die Triebköpfe der Baureihe 401 entsprechen äußerlich weitgehend denen des InterCityExperimental und beinhalten Innovationen aus den Lokomotiven der Baureihe 120 und der Bauart DE 2500.[35] Markante äußerliche Unterschiede sind unter anderem der horizontale „Knick“ in 1,80 m Höhe, die geringere Anzahl an Lüftungsgittern, der „Kühlergrill“ auf der Front sowie die Fortführung des Zierstreifens über den Bug. Der Fahrzeugkasten entstand in Stahlleichtbauweise mit Seitenwänden aus glatten profilversteiften Blechen. Die „Nase“, unter der sich eine Scharfenberg-Notkupplung verbirgt, sowie die Seitenwandschürzen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.[36][37]
Auf jedem der ursprünglich insgesamt 120 ICE-1-Triebköpfe wurde ein neu entwickelter Stromabnehmer der Bauart DS 350 S installiert.[37] (andere Quelle: DSA 350 S[38]) Diese Bauart bewährte sich im Alltag leider nicht und musste weiterentwickelt werden. Die ICE 2 bekamen den verbesserten Typ DSA 350 SEK und wurden später auch auf die Triebköpfe des ICE 1 montiert.[38][39]). 38 Triebköpfe (401.072 bis 401.090 und 401.572 bis 401.590) erhielten einen weiteren Pantographen mit einem schmaleren Schleifstück, um auch in der Schweiz den Zug mit Energie aus der Oberleitung versorgen zu können.[38] Auf eine Starkstromleitung zwischen den beiden Triebköpfen wurde verzichtet, weshalb immer zwei Stromabnehmer pro Zugverbund am Fahrdraht anliegen müssen. Jeder Triebkopf wird durch vier fremdbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit einer Leistung von je 1200 kW angetrieben. Die Drehstromtechnik wurde mit der Ellok der Baureihe 120 zur Serienreife entwickelt und zeichnet sich durch ein geringes Gewicht, kompakte Einbaumaße und einen geringen Wartungsaufwand aus. Der Antriebsblock ist dem der dieselelektrischen Lokomotive vom Typ DE 2500 ähnlich. Dessen sogenanntes „UmAn“-Prinzip (Umkoppelbare Antriebsmasse) sorgt für einen verminderten Verschleiß zwischen Rad und Schiene, sowohl in engen Bögen als auch bei Schnellfahrten auf geraden Strecken. Die Drehgestelle sind stahlgefedert. Zwei verschiedene Bremssysteme sind im Triebkopf implementiert. Die elektrische Netzbremse – die Motoren fungieren beim Bremsen als Generatoren – erlaubt eine Energierückspeisung in die Oberleitung. Elektropneumatische Scheibenbremsen können bei Bedarf hinzugeschaltet werden. Auf die innovative Wirbelstrombremse des IC-Experimental wurde verzichtet, da das starke Magnetfeld Komponenten entlang der Gleisanlage stören könnte.[35][36][37]
Das Regiezentrum eines Triebkopfes bildet die druckdichte Fahrerkabine. Zehn Rechnersysteme unterstützen den Fahrer während der Fahrt und bei eventuell auftretenden Störungen. Alle wichtigen Betriebsdaten werden auf zwei Displays angezeigt – teils auch noch zusätzlich durch analoge Armaturen. Ein Display zeigt die Zustände im führenden Triebkopf, eines die Werte für den hinteren. Zusätzlich besitzt der ICE ein elektronisches Diagnosesystem, „DAVID“ genannt (Diagnose-Aufrüst- und Vorbereitungsdienst mit Integrierter Displaysteuerung). Es erkennt Störungen und Fehler, die im Zugverbund auftreten. Dem Triebfahrzeugführer werden nicht nur Hinweise auf Ursache und Ort der Störung mitgeteilt, sondern auch Handlungsempfehlungen gegeben.[37][40] Mindestens ein Defizit hatte DAVID allerdings: „Die Deutsche Bahn […] musste reichlich Prügel einstecken, weil das Diagnosesystem des ICE 1 zwar Klimaanlagen und Toiletten überwacht, nicht aber das Fahrwerk. Entgleisungsdetektoren, so die Kritik, hätten das [ICE-Unglück bei Eschede] vielleicht verhindert“[41] Noch während der Fahrt schickt der Triebfahrzeugführer bei Hannover die Daten an das Betriebswerk in Hamburg Eidelstedt voraus. Dort weiß man vor Ankunft des Zuges Bescheid, an welcher Stelle welcher Mangel vorliegt und hat bei Einfahrt des Zuges das Ersatzteil schon an Ort und Stelle.[42]
ICE-1-Mittelwagen
In den ersten Betriebsjahren waren vier verschiedene Arten von Mittelwagen zwischen den beiden Triebköpfen eingereiht. Für die ersten 41 Züge bestellte die DB 492 Mittelwagen.[6] Letztendlich summierte sich die Mittelwagenanzahl bei 120 Triebköpfen auf 694.[43] Jeder Wagentyp hat eine bestimmte Baureihenbezeichnung, ähnlich den Triebköpfen:
Anzahl der ICE-Mittelwagen |
||
|---|---|---|
| Avmz 801 | 1. Klasse | 138 Wagen |
| Avmz 801.8 | 1. Klasse + Kartentelefon | 60 Wagen |
| Bvmz 802 | 2. Klasse | 376 Wagen |
| Bvmz 802.9 | 2. Klasse, Drehgestelle mit Luftfederung, wie ICE 2 | 26 Wagen |
| BSmz 803 | 2. Klasse mit Sonderabteilen (Servicewagen) | 60 Wagen |
| WSmz 804 | Speisewagen mit Restaurant und Bistro | 60 Wagen |
|
Insgesamt:
|
720 Wagen[44] | |
Alle Mittelwagen weisen eine Länge von 26.400 mm, eine Breite von 3020 mm und eine Höhe von 3840 mm auf, wobei der Speisewagen eine Scheitelhöhe von 4295 mm hat und im Zugverbund optisch heraussticht. Trotz Leichtbaukonstruktion in Aluminium-Integralbauweise aus Großstrang-Profilen und einer verwindungssteifen Bodenplatte aus Hohlkammerprofilen waren die Mittelwagen ursprünglich sehr schwer. Dazu trägt unter anderem das durchlaufende, mit der Außenhaut bündige Fensterband aus abwechselnd angeordneten Sicht- und Blindfenstern bei. Auch die gute Schall- und Wärmeisolierung fällt mit zehn Prozent ins Gewicht.[45] Vor allem aber trugen die wuchtigen Sitze zum hohen Eigengewicht des ICE 1 bei, die später durch schlankere und leichtere Sitze ersetzt wurden.
Ein weiteres Novum stellten damals die Drehgestelle des Typs MD 530 mit einem Achsstand von 2500 mm für Geschwindigkeiten bis 300 km/h dar.[46] Sie sind konventionell stahl- statt luftgefedert und finden bis heute unter den ICE-1-Zügen Anwendung.[47] Die Mittelwagen verfügen über zwei verschiedene Bremssysteme: eine Scheibenbremsanlage mit jeweils vier Scheibenbremsen pro Achse sowie Magnetschienenbremsen, die leicht gegen Wirbelstrombremsen zu tauschen gewesen wären, was jedoch nie erfolgte. Die Handbremse (Feststellbremse) zählt nicht direkt zum Bremssystem.
Nicht nur die Wagenkästen, Fenster und Türen sind druckdicht ausgeführt, sondern auch der Doppelwellenbalg. Auf die komplexe und teure Außenverschalung der Übergänge wie beim Experimentalzug wurde verzichtet. Auch die anfänglichen Windleitprofile aus Gummi sucht man heute vergebens;[48] einige lösten sich schon nach kurzer Zeit.[49][50] Eine Neuerung waren die druckdichten Horizontal-Schwenkschiebetüren mit ovalen Türfenstern als Notausstieg. Nicht unerwähnt bleiben soll die Kupplungstechnik, die den Zugverbund zusammenhält. Die Zentralkupplung mit seitlichen Bügelverschlüssen war eine völlige Neuentwicklung. Im Kuppelkopf sind die Luftleitungen, zwei Zugsammelschienen für die Energieversorgung, die elektrischen Steuerleitungen und zwei Lichtwellenleiter für die interne Kommunikation zu finden.[37] Die Glasfaserkabel sorgen unter anderem dafür, dass die Fahr- und Bremsimpulse zwischen den rund 400 Meter auseinander liegenden Triebköpfen absolut gleichzeitig erfolgen.
Ab 1991: Das ICE-Betriebswerk in Hamburg-Eidelstedt
Nicht nur die Züge und Neubaustrecken machten die Marke „ICE“ zum Premiumprodukt. Zum Erfolg der Hochgeschwindigkeitszüge trug auch das Hightech-Betriebswerk in Hamburg-Eidelstedt maßgeblich bei – was übrigens das erste seiner Art in Deutschland war. Bei der Wartung der ICE-Züge wurden Maßstäbe gesetzt, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Jahr 1991 weltweit ihresgleichen suchten. Im Folgenden wird berichtet, wie die ICE-Züge Anfang der Neunzigerjahre im Betriebswerk für die nächste Tour durch Deutschland fit gemacht wurden. Ich entschied mich für das Schreiben in der Vergangenheitsform, da ich nicht beurteilen kann, welche Abläufe und Gegebenheiten immer noch Gültigkeit haben.
In der 430 Meter langen Halle konnte an bis zu acht ICE-1-Zügen mit maximal 14 Mittelwagen gleichzeitig gearbeitet werden. Die Wartungsdauer war auf eine Stunde festgelegt, in der alle notwendigen Reparaturen und Reinigungen am und im Zug vorgenommen wurden. Die Gleise in der Halle waren aufgestelzt, sodass keine Grube für die Unterflur-Checks und -reparaturen benötigt wurde. Es gab insgesamt drei Ebenen, auf denen das 70-köpfige Team an einem Zug gleichzeitig und voneinander unabhängig arbeiten konnte.
Ebene 1
Sie lag 2,4 Meter unter Schienenoberkante (SO): Von dieser Ebene aus fand der Materialtransport statt. Des Weiteren wurden dort alle Arbeiten an den Rädern, Drehgestellen, Bremseinrichtungen, bei den Triebköpfen auch an Transformatoren und Ölkreisläufen erledigt. Zugleich diente die Ebene der Entsorgung von Müll und der Leerung der Vakuum-Toiletten. Im Boden waren Leitbänder eingelassen, die die Arbeitshubwagen und Luftkissenfahrzeuge induktiv führten. Die Arbeiter brauchten sich also nicht mehr um den Fahrweg der Arbeitswagen kümmern und konnten sich voll auf die Checks und Reparaturen unter dem ICE-Zug kümmern.
Aufgrund der Tatsache, dass damals ein ICE-Zug am Tag bis zu 1900 Kilometer zurücklegte, mussten die Laufwerke bei jedem „Boxenstopp“ geprüft werden. Der Zug durchfuhr zunächst die zehngleisige Abstellanlage und dann zwangsläufig auf ein Gleis mit der Ultraschall-Mess- und Diagnoseanlage für die Radsatz-Laufflächenkontrolle. Danach fuhr der Zug mit eigener Kraft in die Wartungshalle. Falls notwendig, wurden bei den Triebköpfen ganze Drehgestelle getauscht. Dazu waren die aufgestelzten Schienen insgesamt 120 Mal unterteilt. Die Gleisbrücken konnten seitlich mit dem auszubauenden Teil herausgefahren werden, wobei Abstützungen und Verriegelung die Arbeitssicherheit gewährleisteten. Die einfahrenden Züge mussten deswegen natürlich an den richtigen Positionen zum Stehen kommen.
Luftkissenfahrzeuge nahmen die nach nur 10 Minuten ausgebauten Laufradsätze auf und transportierten sie ab für die Aufarbeitung im Ausbesserungswerk. Da bei den Triebköpfen der Ausbau von den Drehgestellen problematischer ist, wurden diese so spät wie möglich gewechselt. Bei geringeren Verschleißerscheinungen (z. B. unrund gefahrene Räder) wurden die noch am Zug gekoppelten Triebköpfe zur Unterflur-Radsatz-Drehmaschine gefahren. Dort konnten die Räder im eingebauten Zustand abgedreht werden.
Ebene 2
Sie befand sich 1,2 Meter über SO: Dabei handelte es sich um pilzförmige Bühnen, die den niveaugleichen Einstieg in die Türen der Mittelwagen ermöglichten. Auf ihnen konnten auch Fahrzeuge fahren. In dieser Etage wurden die Innenräume gereinigt. Die Ebene 2 diente der Ver- und Entsorgung aller Fahrgasteinrichtungen, und der Speisewagen konnte wieder mit Verpflegung aufgefüllt werden. Kleinere Tauscharbeiten an der Fahrzeugelektronik und Beleuchtung konnten von diesen Pilzbühnen aus vorgenommen werden. Ein ausgeklügeltes System von Aufzügen und Fallschächten sorgte für die notwendige Materialab- und -zufuhr. Mithilfe von Hängebühnen, die gegenüber den Pilzbühnen hängten, konnten eventuell notwendige Arbeiten an den Außenwänden, Türen und Fenstern durchgeführt werden.
Ebene 3
Diese lag 3,8 Meter über SO. Sie existierte nur im Bereich der Triebköpfe. Von dort aus hatte man Zugang zu den Dachausrüstungen (Stromabnehmer, Dachsegmente für den Ausbau der elektrischen Baugruppen durch den Kran). Hier war die Oberleitung unterbrochen. Bei Bedarf konnten verfahrbare Oberleitungsbrücken anstelle der Oberleitung gesetzt werden. Teilweise war die oberste Ebene auch im Mittelwagenbereich installiert, um die schweren Aggregate der Klimaanlagen leichter herausholen zu können.
Damit die Aufenthaltsfrist von nur einer Stunde eingehalten werden konnte, war eine perfekt eingespielte Arbeitsvorbereitung, Materialdisposition und Logistik erforderlich. Diese wurde durch eine rechnergestützte Datenverarbeitung und -speicherung realisiert. Alle am Zug arbeitenden Personen besaßen eine Magnetkarte, mit der sie sich bei einem Computer anmeldeten. Erst wenn jeder wieder mit der Magnetkarte nach getaner Arbeit signalisierte, dass er fertig war, konnte der Zug fahren. Dadurch wurde vermieden, dass aus Versehen jemand im ICE eingeschlossen wurde und mitfuhr.
Um die benötigten Sachen schon beim Einfahren des Zuges an Ort und Stelle zu haben, dachten sich die Ingenieure folgendes System aus: In den Triebköpfen und Mittelwagen waren Diagnoserechner eingebaut und speicherten zunächst alle Betriebs- und Störungszustände. Diese klassifizierte man nach Bedeutung und Wertigkeit. Über den Zugbus, einem Lichtwellenleiter, wurden diese Informationen zum führenden Triebkopf geschickt. Spätestens im Raum Hannover sendete der ICE-Triebfahrzeugführer per Knopfdruck alle gespeicherten Stör- und Fehlermeldungen zur Zentrale ins Betriebswerk Hamburg Eidelstedt. Dort waren wiederum alle verfügbaren Ersatzteile sowie deren Zeichnungen und Schaltpläne in der EDV auf Abruf gespeichert. Sofern jedoch der mit dem Ersatzteil entsandte Mitarbeiter den Fehlerort nicht sofort finden oder lokalisieren konnte, bestand die Möglichkeit, über ein elektronisches Bildplattensystem Zeichnungen und Abbildungen sowie Daten aller Art auf Bildschirme oder Drucker direkt am Arbeitsplatz zu übertragen. Nach einer gewissen Periode wurden die ICE-Züge aber noch eingehender untersucht; dafür reichte eine Stunde nicht mehr aus. Dann blieben sie ein paar Tage lang im ICE-Werk Eidelstedt.[51][52][53][54][55]
1993: ICE-Werbefahrten in den USA
In den USA kamen erneut Gespräche über eine Schnellbahnverbindung von Washington via New York nach Boston in Gang. Sowohl die deutsche als auch die schwedische Schienenfahrzeugindustrie bewarben sich auf außergewöhnlicher Weise, um den Zuschlag zum Bau der Züge zu erhalten: Sie schickten je einen X2 und ICE 1 auf Reisen in die USA. Amtrak mietete den ICE 1 an.[56]
Für Test- und Präsentationsfahrten wurde eine 8-teilige ICE-Einheit vorbereitet und auf das dortige Stromsystem mit 11 kV 25 Hz Wechselspannung umgerüstet[57] (andere Quelle: 12 kV 25 Hz[58]). Auch der Stromabnehmer, das Radprofil, die Trittstufen und die Telefone mussten geändert werden. Das Fahrgastinformationssystem (FIS) fütterte man mit Daten für den Plandienst in den USA. Am 19.06.1993 wurde der Amtrak-ICE in Bremerhaven „in Einzelteilen“ auf ein Schiff verladen.[57] Nach 10 Tagen auf See traf der ICE in Baltimore ein, wo die 6 Wagen und 2 Triebköpfe wieder zusammengefügt wurden. Eine Diesellok überführte den Amtrak-ICE nach Washington D.C.
Nach der Schulung des Personals und kurzen Probefahrten startete der Hochgeschwindigkeitszug am 7. Juli 1993 zu seiner ersten Reise nach Philadelphia. Bei weiteren Versuchsfahrten erreichte der ICE eine Höchstgeschwindigkeit von 260,7 km/h. Am 29. Juli begann die Präsentations-Rundreise „ICE Train North America Tour ’93“ zu 25 Großstädten der USA. Anschließend konnten sich auch die Fahrgäste vom Komfort des „ice-train“ überzeugen. Ab dem 8. Oktober wurde der ICE für zwei Monate im Pendelverkehr zwischen Washington und New York als Metroliner mit bis zu 217 km/h eingesetzt. Das ICE-Abenteuer kostete zwischen 15 und 20 Millionen DM. Letztendlich wurde weder der schwedische X2 noch der deutsche ICE genommen, sondern ein Konsortium aus Bombardier und Alstom ausgewählt, das den Acela herstellen durfte.[59]
ICE 1 im Plandienst: 1994–1998
400.000 befragte Reisende bewerteten das Flaggschiff ob seiner komfortablen Einrichtung und dem Preis-Leistungsverhältnis im Durchschnitt mit der Note 2,1.[60] Der ICE wurde auch für Dienstreisende zum Trendsetter. Von den neuen Bahnfahrern stiegen 64 Prozent aus dem Auto und 36 Prozent aus dem Flugzeug in den ICE um. 65.000 Fahrgäste waren täglich mit dem ICE unterwegs.[60] „Der Ansturm auf den ICE hat selbst die Optimisten in den Führungsetagen der Deutschen Bahn überrascht“[61]Auch kleine Städte wollten vom ICE profitieren und die Stadtpolitiker machten bei der Bahn Druck.[60]
Die DB hatte sich mit der prozentualen Aufteilung der Sitzplätze in erste und zweite Wagenklasse etwas verkalkuliert gehabt. Es standen zu wenig Zweitklassplätze zur Verfügung,[62] weswegen manche Erstklasswagen ohne Modifikation der Inneneinrichtung für Fahrgäste der zweiten Klasse freigegeben wurden. Auch bestellte die DB 26 Zweitklasswagen der Baureihe Bpmz 802.9 nach.[63] Diese besitzen allerdings die komfortable Luftfederung, denn die ICE-2-Produktion lief bereits an.[45] Von da an konnte man auch wieder 15-teilige ICE-1-Züge mit 13 Mittelwagen sehen.[49]
Bis 1994 waren die ICE-Züge in der Schweiz eher eine Randerscheinung, denn sie fuhren bis dato nur bis Basel und Zürich. 1995 wurden jedoch einige Zugläufe über Spiez nach Interlaken verlängert.[64] Österreich kam erst 1998 in den Genuss der komfortablen ICEs. Die überbreiten Hochgeschwindigkeitszüge erlangten damals die Betriebsgenehmigungen unter anderem für die Strecken Wien – Wels – Passau, Wels – Salzburg, Kufstein – Innsbruck, Wörgl – Salzburg sowie Linz – Bischofshofen. Auch einen innerösterreichischen Lauf gab es mit dem ICE 966/967.[65]
ICE-D
Bereits Mitte der Neunzigerjahre stand fest, dass das Triebzugkonzept (Triebkopf – antriebslose Mittelwagen – Triebkopf) nicht der Weisheit letzter Schluss sei. Um die künftige Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln mit Steigungen von bis zu 40 Promille mit Tempo 300 befahren zu können, sollte der Antrieb über den gesamten Zug verteilt sein; man spricht hier vom Triebwagenzug.
Um Erfahrungen mit angetriebenen Mittelwagen zu sammeln, ließ man nicht nur den ICE-S (S: Schnellfahrerprobung) bauen, sondern auch einen weiteren, angetriebenen Mittelwagen mit der Baureihenbezeichnung 410.203. Ein Drehgestell hatte einen konventionellen Hohlwellenantrieb, das andere einen neuen Antrieb mit Bogenzahnkupplung.[66] Dieser Mittelwagen beinhaltete einen Stromrichter und Transformator und wurde am Ende eines regulären ICE-1-Wagenverbundes hinter der 2. Klasse eingefügt. Die ICE-1-Triebköpfe 401.013 und 401.513 ersetzte man durch die ICE-2-Triebköpfe 402.013 (am Ende der 1. Klasse) und 402.014 (verbunden mit 410.203).[67] Unklar ist jedoch, ob alle vier Motoren im Mittelwagen vom Stromrichter im Triebkopf[66] oder vom Stromrichter im Wagen versorgt wurden. Widersprüchlich sind auch die Angaben, ob beim 402.014 das vordere[67] oder hintere[66] Drehgestell abgeschaltet wurde. Diese Zugkonfiguration wurde „ICE-D“ genannt, wobei das D für Dauererprobung stand. Von April 1997 bis Mai 1999 konnten wertvolle Daten gesammelt werden, die der Entwicklung der Antriebe für den ICE 3 dienlich waren.[67]
1998: ICE-Unglück von Eschede
Der wohl schwerste Unfall mit einem Hochgeschwindigkeitszug war das ICE-Unglück von Eschede. Am 3. Juni 1998 entgleiste ein ICE der ersten Generation mit der Nummer 884 und dem Namen „Wilhelm Conrad Röntgen“ bei der Ortschaft Eschede. Mit 198 km/h brachte der Zug eine Autobrücke zum Einsturz, die einen Teil des ICE unter sich begrub.[68] 101 Menschen starben, 105 Menschen wurden teils schwer verletzt.[69] Eine Verkettung mehrerer, unglücklicher Umstände sowie Versäumnisse bei der Wartung führten zu der Katastrophe.
Gummigefederte Räder
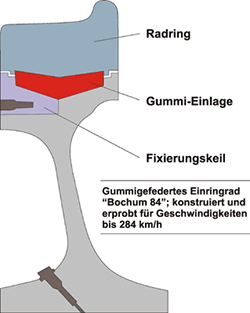
Die Serienzüge der ersten ICE-Generation erhielten für die Mittelwagen stahlgefederte Drehgestelle der Bauform MD 530.[44] Erst für den ICE 2 waren luftgefederte Drehgestelle vorgesehen, denn diese mussten erst noch „anwendungsreif entwickelt werden“.[22] Doch bei hohen Geschwindigkeiten fing der ICE 1 an zu vibrieren. Eine Umrüstung auf luftgefederte Drehgestelle kam nicht infrage. Es wurde entschieden, gummigefederte Räder der Baureihe 64 einzubauen, wie man sie von einigen Straßenbahnen kannte[70] – zuerst nur unter den Restaurantwagen, dann unter den ganzen Zugverbund.[24] Langzeiterfahrungen mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h fehlten.[71]
„Mehrere Monate vor dem Unglück hatte der hannoversche Verkehrsbetrieb Üstra AG Radreifenbrüche bei seinen Straßenbahnen weit vor der erwarteten Verschleißzeit festgestellt und Warnungen vor verfrühten Ermüdungserscheinungen verschickt – auch an die DB AG. Da es jedoch im Detail konstruktive Unterschiede zwischen den Nahverkehrsrädern und den Rädern des ICE gab, hat die Bahn keine Konsequenzen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gezogen“[72][73] Der ICE 1 ist mit dem Onboard-Diagnosesystem DAVID und einer Zentraleinheit für die Überwachung und Steuerung ZEUS ausgerüstet. Die beiden Einrichtungen erfassen Mängel und Auffälligkeiten am Zug. Insgesamt acht Mal wurden die Fehlermeldungen „Flachstelle“ und „Unruhiger Lauf“ am Unglücks-Drehgestell registriert bzw. vom Zugpersonal eingegeben und automatisch an das ICE-Werk in Hamburg-Eidelstedt übermittelt.[68] Aber niemand wechselte in dieser Zeit den schadhaften Radsatz aus. Am 2. Juni 1998 wurde der ICE routinemäßig im ICE-Werk in München inspiziert. Er passierte unter anderem eine Radsatz-Diagnoseeinrichtung. Sensoren maßen das zwischen Rad und Schiene entstehende Laufgeräusch, und drei voneinander unabhängige automatische Messmodule suchten nach Querrissen, Profilabweichungen und Flachstellen. Alle Messungen des Rades zeigten so unglaubwürdig schlechte Ergebnisse an, dass man an Fehlmessungen glaubte und ließ das Rad im Drehgestell.[74] Bei der letzten Kontrolle sei eine Unrundheit von 1,1 Millimetern festgestellt worden. Bei einem Grenzwert von nur 0,6 Millimetern hätte man den Radsatz bereits auswechseln müssen.[75]
Die Fahrt nach Hamburg
Die Fahrt des Unglückszuges begann am nächsten Tag, den 3. Juni 1998 um 5:47 Uhr in München. Um 10.56 Uhr, kurz hinter Celle, hörten einige der ungefähr 287 Reisenden einen lauten Knall.[68] Am hinteren Drehgestell des ersten Wagens (dritter Radsatz) war der fehlerhafte, verschlissene Radreifen abgesprungen und verhakte sich im Drehgestell.[24] Ein Teil des Radreifens durchbohrte den Fußboden und trat zwischen zwei Sitzen in den Fahrgastraum.[76][77] Ein Reisender informierte den Zugbegleiter, der jedoch vom Wagen 3 Zeit brauchte, um nach vorne zu kommen.[77] Über eine Strecke von 5,5 Kilometern hielt die Radscheibe stabil die Spur, wobei der abgesprungene Radreifen die Betonschwellen zerkratzte.[76] Auch die Kabel der Linienzugbeeinflussung wurden beschädigt.[78]
Nun forderte der herkömmliche, günstigere Weichentyp seinen Tribut. Im Herzstück dieser Weiche befindet sich eine Lücke zwischen dem geraden und abbiegenden Schienenstrang. Radlenker am gegenüberliegenden Schienenstrang sorgen dafür, dass der Zug beim Durchfahren der Lücke in der Spur bleibt. Der Radreifen schlug gegen den Radlenker, der daraufhin von der Weiche abgesprengt wurde und sich durch den Boden bis zur Decke in den Wagen rammte. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste das zweite Drehgestell des ersten Wagens. An der dritten Weiche stellte das entgleiste Rad die Weiche um. Wagen 2 wurde mit 198 km/h auf das Nebengleis gezogen, doch erst Wagen 3 rammte den Brückenpfeiler, der von der Wucht zerschmetterte.[79] Durch den Ruck trennten sich die Wagen vom führenden Triebkopf. Wagen 4 überschlug sich und blieb in der Nähe der Gleisanlage liegen. Die Brücke fiel in sich zusammen. Der fünfte Wagen wurde von fallenden Brückenteilen in der Mitte auseinandergerissen, der sechste Wagen komplett darunter begraben. Alle weiteren Mittelwagen schoben sich im Ziehharmonika-Effekt vor bzw. auf die Brücke. Der hintere Triebkopf entgleiste, blieb aber verhältnismäßig unbeschadet. Der führende Triebkopf kam erst nach rund zwei Kilometern unversehrt zum Stehen.[77][80] Durch schnelles Handeln eines Fahrdienstleiters konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Dieser sah, dass nur der Triebkopf an ihm vorbeifuhr und stellte die komplette Strecke auf „gesperrt“. Damit wurde verhindert, dass ein entgegenkommender Zug in das Unglücksgebiet fuhr.[81]
Was geschah nach dem Unglück?
Die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauerten mehrere Wochen. Alle Züge zwischen Hannover und Hamburg mussten umgeleitet werden. Zuerst wurden die ICE-1-Züge vorsorglich zu Radkontrollen einberufen. Für die wieder eingesetzten ICEs der ersten Generation beschränkte die DB die Höchstgeschwindigkeit von auf 160 km/h. Am 6. Juni beschloss das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), die ICE-1-Züge komplett aus dem Verkehr zu ziehen, um eine 12 Stunden dauernde Ultraschall-Diagnose der Radreifen durchzuführen.[24] Danach waren wieder einige ICEs der ersten Generation im Plandienst. Später zog die DB alle ICE 1 erneut ein, um die gummigefederten Räder wieder durch Vollräder zu ersetzen.[97] Die Stahlfederung wurde jedoch beibehalten – die Drehgestelle für eine Luftfederung umzurüsten war offenbar nicht durchführbar. Damit brummen die ICE-1-Züge wieder wie vor dem Einsatz des gummigefederten Rades.[82]
Der vorübergehende Ausfall der 60 ICEs machte sich im alltäglichen Bahnbetrieb stark bemerkbar. Es gab tagtäglich stundenlange Verspätungen. Zugläufe mussten geändert oder gestrichen werden. Alte, abgestellte Wagen kamen wieder auf die Strecken. Lokbespannte Züge füllten die Lücken in provisorischen Fahrplänen. Züge und Wagen aus Österreich und der Schweiz wurden angemietet.[24] Wochen später kamen nach und nach verkürzte ICE-1-Einheiten auf die Strecke, aber erst zum 1. November 1998 waren alle 59 ICEs der Baureihe 401 wieder in normaler Länge verfügbar.
Sind gummigefederte Räder für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt?
Schon lange vor dem Unglück hatte es in Fachblättern wie dem „Eisenbahningenieur“ und „Eisenbahn-Magazin“ Warnhinweise auf die Probleme mit der gummigedämpften Radkonstruktion gegeben. Sie ist ursprünglich für Straßenbahnen und Stadtbahnwagen und nicht für den Hochgeschwindigkeitsverkehr entwickelt worden. Nachweise zur Betriebssicherheit dieses Radtyps wurden nicht erbracht.[70] Offensichtlich gab es jedoch in den rund sechs Jahren und Millionen von Kilometern bis zu dem Unglück keine gravierenden Probleme.[83] Interessanterweise sei zu keiner Zeit auf internen Schulungen davon gesprochen worden, dass bei dieser Bauart ein Radreifenbruch von innen stattfinden könne.[70] Möglicherweise hätte eine Röntgenprüfeinrichtung für ICE-Radreifen, die sich selbst unter rauen Bedingungen wie in Walzwerken bewährt, den Riss erkannt. Doch war bereits in den Achtzigerjahren aus Kostengründen darauf verzichtet worden.[70] Eine weitere Rolle soll die starke Erwärmung des Gummis gespielt haben. Dieser dehnte sich aus und der Radreifen musste die Kräfte aufnehmen. Zur Materialermüdung hat auch die Elastizität der Radkonstruktion beigetragen. Der Radring wurde durch das Gewicht des Zuges, die Rollbewegung und die Nachgiebigkeit des Gummis regelrecht durchgewalkt – 500.000 mal täglich![84]
Fanden vor dem Unglück Kontrollen am Rad statt?
Ja. Am Tag zuvor wurde aufgrund der Eingaben des Zugpersonals das Rad mit Hilfe eines ULM (Ultraschall-Lichtschnitt-Messbalken) geprüft. Die Messergebnisse hatten so viele Alarmwerte aufgewiesen, dass niemand sie glauben mochte.[74] Für rund ein Drittel der Radsätze hatte das automatische Überwachungssystem ULM klassische Fehlmessungen geliefert.[74] Obwohl der Durchmesser von ICE-Rädern durch Verschleiß im Betrieb abnimmt, seien bei den letzten Kontrollen der Räder des ICE oft Zuwächse gemessen worden. Mehrmals habe das Kontrollsystem sogar einen weit größeren Durchmesser als den von Neurädern diagnostiziert.[85] Am Unglücksrad stellte man eine Unrundheit von 1,1 Millimetern fest. Das Betriebsgrenzmaß für Unrundheiten, ab dem das Rad auszuwechseln war, lag jedoch bei 0,6 Millimetern. Dennoch tauschte niemand das Rad aus.[85] Das unzulängliche Ultraschallprüfsystem konnte zudem nur Risse, die an der Oberfläche entstehen, orten, von innen entstehende Risse jedoch nicht.[86]
Was passierte mit den übrigen, einigermaßen intakten Teilen des Zuges?
Zuerst wurden alles Teile des ICE vom Eisenbahnbundesamt (EBA) beschlagnahmt. Ein Mitglied des Katastrophenschutzes erläuterte, was weiter mit diesem Zug geschah: „Ende Juni / Anfang Juli 1998 wurden die gesamten Überreste des ICE zur Bundesschule der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk nach Hoya (Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen) per Tieflader überführt. Nachdem das Eisenbahnbundesamt die Überreste dann einige Monate später freigegeben hatte, bekam die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk als Bundesorganisation den ICE „geliehen“; die DB wollte den ICE nicht zurück. Im Frühjahr 2000 wurde dann eine ‚Inventur‘ gemacht, was noch als Übungsobjekte zu gebrauchen ist und was nicht. Die so gut wie intakten Teile des ICE stehen bis heute hinter stark verschlossenen Hallentoren in Hoya, jedoch teilweise nicht mehr auf dem Gelände der Bundesschule. Die nicht mehr brauchbaren Überreste wurden nach München zu Krauss-Maffei überführt und dort recycelt.“[87]
Warum zog niemand die Notbremse?
Spätestens, nachdem der Radreifen durch den Boden in den Fahrgastbereich eindrang, hätten die Fahrgäste die Notbremse ziehen müssen. Stattdessen hatte man offenbar Angst, wegen Missbrauch bestraft zu werden. Deswegen ging ein Fahrgast auf die Suche nach dem Schaffner. Drei Wagen weiter hinten konnte ein Zugbegleiter gefunden werden, doch er wollte sich zuerst vergewissern, ob die Information korrekt sind und ließ den ICE weiterfahren. Während er zu den beschädigten Wagen ging, bemerkte er zwar die starken Schwankungen der Wagen, reagierte aber überhaupt nicht darauf. Gerade am beschädigten Wagen angekommen, kam es zur Katastrophe. Die Fahrgäste und der Zugbegleiter hätten also das Unglück mildern, wenn nicht gar verhindern können — menschliches Versagen![80]
Wäre es beinahe zu einem noch schwereren Unfall gekommen?
Ein Zug aus Hamburg in Richtung Hannover hatte die Unfallstelle bereits knappe zwei Minuten vorher passiert. Der ICE 787 „Karl Adam“ fuhr an jenem 3. Juni eine Minute vor Plan durch Eschede; der ICE „Wilhelm Conrad Röntgen“ hatte dagegen eine Minute Verspätung – eigentlich hätten sich die Züge in Höhe Eschede begegnen müssen.[81]
Welche Maßnahmen wurden inzwischen getroffen, um solche Unglücke zu vermeiden?
Die gummigefederten Räder wurden wieder durch Monobloc-Räder, also Vollstahlräder, ersetzt. Das Brummen und Dröhnen ist seitdem wieder präsent. Leider war es offensichtlich nicht möglich, die Drehgestelle mit Stahlfederung gegen Fahrgestelle mit Luftfederung auszutauschen. Ein paar Jahre später kamen Fenster mit Sollbruchstellen zum Einsatz, da die Feuerwehr enorme Probleme hatte, in den kaputten Zug zu kommen. Die Wagen glichen uneinnehmbaren Festungen.[88] Die vorhandenen Trennschleifer versagten an den Metalllegierungen der Außenwände. Die druckdichten Fenster ließen sich kaum zertrümmern, zerschneiden oder aus den Rahmen trennen.[89] Später sollten die ICE-Züge mit einem neuen Warnsystem gegen Entgleisungen ausgestattet werden. Ab 1999 arbeiteten Techniker des Forschungs- und Technologiezentrums der Deutschen Bahn und von iSTec an der Entwicklung eines Frühwarnsystems, das Schäden an den ICEs bereits im Frühstadium erkennen sollte. Etwa 40 Beschleunigungssensoren am jedem Drehgestell maßen dafür die Schwingungen und Vibrationen der Bauteile. Aus der Veränderung des Schwingungsverhaltens kann man Rückschlüsse auf Materialermüdung ziehen. Trotz variierendem Gleisoberbau soll es einwandfrei funktioniert haben, was Testfahrten mit einem modifizierten ICE-2-Mittelwagen bewiesen.[90] Ob die bestehende ICE-Flotte mit Sensoren nachgerüstet wurde, ist mir unbekannt. Im Velaro D haben die Radlager zumindest Platz für zusätzliche Sensoren bekommen. Bei dieser Baureihe 407 gibt es außerdem Fühler zur Temperaturüberwachung der Radsatzlager, zur Stabilitätskontrolle und Schwingungssensoren, die den Zustand bestimmter Drehgestellbauteile überwachen.[91] Bei Planungen von neuen Strecken soll auf Weichen und Überleitungen vor Brücken und Tunneln verzichtet werden.[92]
Was kostete das ICE-Unglück bei Eschede?
1999 bezifferte die DB „die materiellen Unfallfolgen mit 150 Millionen Mark, davon entfallen auf Umsatzverluste allein 100 Millionen“.[92] Die Angehörigen der Todesopfer verlangten 125.000 Euro Schmerzensgeld, erhielten aber nur 30.000 Mark.[93] Zusätzlich bezahlte die Bahn eine Gedenkstätte am Unglücksort.[94] Eine andere Quelle gibt an, 25 Millionen Euro für die Überlebenden und an die Angehörigen der Toten gezahlt zu haben.[95]
Die immateriellen Schäden durch Traumata und Verluste von Angehörigen sind jedoch durch keinen Betrag zu beziffern. In verschiedenen Dokumentationen berichten Helfer und Einsatzkräfte von Szenen, die sie noch heute schwer belasten: entstellte Menschen und Schreie von Überlebenden. Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen sind oft die Folge.[76][78][96]
ICE 1 im Plandienst: 1998 bis 2008
Am 1.11.1998 endete der ICE-Ersatzverkehr mit ICE-2- und IC-Zügen.[97] In den Folgejahren wurden in den verbliebenen 59 ICE-1-Garnituren andere Fensterscheiben mit Sollbruchstellen eingebaut. Diese sind am dunklen Rahmen und den roten Punkten gut zu erkennen.[98] Auch gab es simulierte Unfälle als Katastrophenschutz-Übung, um für Notfälle besser gewappnet zu sein – so zum Beispiel im Juli 1998 bei Burgsinn[99] und im April 2002 auf der Neubaustrecke Köln – Rhein/Main.[100]
Weitere Pannen und Unfälle mit ICE-1-Zügen
Zwischenfälle mit ICEs der Baureihe 401 gab es immer wieder. Bei 13 Zügen entdeckte man Anfang April 2000 schadhafte Schweißnähte im Bereich der Drehgestelle der Triebköpfe, woraufhin bis August alle 59 Einheiten nachgebessert werden mussten. Ersatzweise kamen ICE-T und lokbespannte Züge zum Einsatz.[103][104] Im Oktober des gleichen Jahres verlor ein Zug eine Schraube an einem Achslenker, woraufhin alle ICE 1 überprüft wurden.[101] Im April 2001 wurde ein ICE wegen einem heißgelaufenen Drehgestell mit starker Rauchentwicklung auf der Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart gestoppt – ausgerechnet in einem Tunnel, dem denkbar ungünstigsten Ort![102] Am 22.11.2001 brannte ein ICE-1-Triebkopf aus.[105] Auch in den Jahren danach brach immer wieder Feuer in den Triebköpfen aus.[106] Zudem fuhren ICE-Züge wiederholt zu schnell über Weichen; Reisende verletzten sich dabei.[107][108]

2006 kam es zu einer folgenschweren Kollision eines ICE mit einer Doppellok der BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) im schweizerischen Thun. „Durch die Wucht des Aufpralls entgleisten etwa zwei Drittel des mit zwölf Wagen sowie vorne und hinten mit je einem Triebwagen bestückten ICE. Der Sachschaden am deutschen Zug sei beträchtlich. Vor allem die Wagenübergänge seien durch die Kollision zusammengedrückt worden“[109] Glücklicherweise wurden nur acht leicht verletzt.[110]
Heftig war die Entgleisung eines ICE 1 im rund 10,8 Kilometer langen Landrückentunnel der Schnellfahrstrecke Hannover – Würzburg. Am Nordportal befand sich eine verirrte Schafherde. Nach dem Aufprall des Triebkopfes auf die Tiere kam der Zug erst drei Kilometer im Tunnel zum Stehen – teile entgleist und gekippt. 20 Schafe verendeten beim Unfall.[111] Bereits wenige Minuten zuvor überfuhr ein ICE in Gegenrichtung ein Schaf, stoppte, fuhr dann aber weiter. Es wurde auch eine Meldung an die Betriebszentrale in Frankfurt am Main abgegeben. Doch das Gegengleis, auf dem dann der Unfall passierte, wurde nicht wie vorgeschrieben gesperrt.[112] Glücklicherweise fuhr kein Gegenzug in die Unfallstelle! Trotzdem: 19 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen mittelschwer.[112]
Auch das Rettungskonzept wurde kritisiert: „Offenbar wollte die Bahn aus Imagegründen den Eindruck vermeiden, es handle sich um ein großes Unglück und alarmierte deshalb die Rettungszüge so spät“[113] „Nach Feuerwehr-Angaben traf der Zug eine Stunde nach dem Unfall am zehn Kilometer entfernen Tatort ein.“[113] Weil man sich nicht sicher war, ob Personen im südlichen Bereich des Tunnels waren, ließ man den Tunnelrettungszug „etwa eine Stunde unverrichteter Dinge am Tunneleingang warten“.[113] Bemängelt wurden zudem die Übermittlung einer falschen Kilometerangabe, eine unzureichende Weitergabe von Informationen, dass einer der beiden Triebfahrzeugführer des Rettungszuges nicht nüchtern war, fehlende Kenntnisse im Umgang mit notwendigen Aggregaten, nicht im Vornherein an die Feuerwehr ausgehändigte Schlüssel für die Türen zu den Rettungsstollen sowie eine fehlende Löschwasserversorgung an den Tunnelportalen.[114]
Kleine Veränderungen an den ICEs der ersten Generation
„Fliegen auf Höhe Null“ genossen Kunden der Lufthansa ab März 1982 zwischen Düsseldorf Hbf und Frankfurt am Main Flughafen. Der besondere Reiseservice endete im Mai 1993.[115] Auch im ICE endeten in jenem Jahr die reservierten Plätze für Fluggäste. Nach reichlich Kritik führte die DB zusammen mit Lufthansa unter der Marke „AIRail“ im Frühjahr 2001 wieder eine zweistündige Bahnverbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt am Main ein.[17] „Der entscheidende Punkt [sei] vor allem eine zügige und zuverlässige Gepäckbeförderung“[116] Für Lufthansa-Kunden baute man daher 21 Erstklasswagen um. Ein Bereich fungierte als Frachtraum für Gepäck. Die Gepäckstücke wurden auf Rollcontainer verladen, die dann komplett in den Zug geschoben wurden.[117][118] Das Konzept bewährte sich so gut, dass es 2003 auf die Relation Köln – Frankfurt am Main Flughafen ausgeweitet wurde. Natürlich profitierte die Lufthansa vom Flug in Höhe Null: „Die Kranich-Linie k[o]nnte so die Zahl ihrer unwirtschaftlichen Ultrakurzstreckenflüge reduzieren und am Frankfurter Flughafen w[u]rden einige der knappen Start- und Landerechte für lukrativere Flugverbindungen frei“[119]
In der Schweiz wurde die Schnellfahrstrecke Mattstetten – Rothrist mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet. Damit die Schweiz-tauglichen ICE 1 weiterhin nach Interlaken fahren konnten, mussten sie eine ETCS-Ausrüstung erhalten. Die Umrüstung kostete rund 23 Millionen Euro und wurden von der Schweiz übernommen. Falls allerdings die DB innerhalb von 10 Jahren in Deutschland ebenfalls ETCS einführen würde, müsse sie das Geld wieder zurückzahlen.[120] Gemäß einer anderen Quelle beliefen sich die Kosten für die Umrüstung auf 22,1 Millionen Euro.[121]
Zum Fahrplanwechsel 2006/2007 kamen die ICE-T-Züge nach Österreich. In Zusammenarbeit entstanden Verbindungen von Wien nach München und nach Bregenz. Ab 2008 verkehrten die ICEs mit Neigetechnik auch zwischen Frankfurt und Wien. Damit endete der Einsatz der ICE-1-Züge in Österreich.[122][123][124]
Renovierung 1: 2005-2008
Als der ICE 1991 sein Debüt gab, ging man von einer Einsatzzeit von 15 Jahren aus.[125] Später fasste man 2010 als Betriebsende ins Auge. Ab diesem Zeitpunkt sollte er vom vom „High Speed Train Europe“ (HTE) ersetzt werden. Finanzielle Engpässe und nationale (technische) Grenzen brachten aber die Pläne zum Scheitern.[126] Zwischen Mitte 2005 und Ende 2008 wurden die ICE-Züge der ersten Generation noch für weitere zehn Jahre fit gemacht. Der Vorstand Personenverkehr begründete dies im Januar 2005 wie folgt: „Der ICE 1 ist ein zuverlässiges und leistungsfähiges Fahrzeug, das bei unseren Kunden einen sehr guten Ruf hat“[127] Eine Bahnsprecherin ergänzte: „Die ICE 1-Flotte fahre in puncto Wirtschaftlichkeit und geringer Störanfälligkeit seit Jahren beste Ergebnisse ein“[127][128]
Das umfangreiche, 180 Millionen Euro teure Modernisierungsprogramm führten diesmal nicht die Hersteller, sondern die Techniker der DB AG selbst durch.[129] Jeder der 59 Züge wurde innerhalb von 25 Arbeitstagen im Werk Nürnberg entkernt, wobei man immer gleichzeitig an zwei Zügen arbeitete. Rund 12.000 Komponenten im Fahrgastbereich wurden ausgebaut und gereinigt, aufgearbeitet oder komplett ausgetauscht. Das nicht mehr zeitgemäße Kunststoffdesign ersetzte man durch eine Inneneinrichtung, wie sie bereits im ICE 3 oder ICE T zu finden ist, wobei die Seitenwände aus Kunststoff in Holzoptik bestehen. Im neuen ICE 1 sind 60 Sitzplätze mehr eingebaut. Dies ist im Wesentlichen durch eine geringere Beinfreiheit erkauft worden. Die schlanken Sitze haben einen Abstand von 92 Zentimetern in der zweiten Klasse und von 101 Zentimetern in der ersten Wagenklasse. Da sich die Fenstereinteilung nicht änderte, müssen sich manche Reisende statt mit einem Fensterplatz nun mit einem Wandplatz begnügen. Das ehemals schmucke Bordrestaurant ist zwar weiterhin höher als die übrigen Wagen, doch die knallroten Ledersitze und kahlen Tische sind nicht jedermanns Geschmack.[130] Wegen der geringen Nutzung der Audio- und Videomodule entfielen diese ersatzlos. Dafür führte die DB im ICE schrittweise einen drahtlosen Internetzugang ein. Zudem ist an jedem Sitzplatz eine Steckdose zum Anschluss von Laptops und anderen Unterhaltungsgeräten montiert. Die Sitzplatzreservierung wird endlich elektronisch angezeigt. Allerdings ist nun nicht mehr erkennbar, ob der Sitzplatz im Laufe einer Fahrt mehrmals hintereinander reserviert ist.[131][132] Weiterhin wurde der Servicewagen der ersten Klasse zugeordnet. Das Konferenzabteil war wohl nicht ausreichend angemietet worden, sodass man es zum Kleinkindabteil umfunktionierte.[133]
Nicht nur der Fahrgastbereich erfuhr eine Grundsanierung. Auf technischer Ebene gibt es zu berichten, dass die Triebköpfe neue Drehgestellrahmen und überarbeitete Bremsen bekamen. Die 38 Schweiz-tauglichen Triebköpfe wurden bis 2007 mit ETCS ausgerüstet.[133][134] Auch die Software erfuhr eine Aktualisierung. Ein häufig geäußerter Wunsch der Reisenden war, endlich auf Luftfederung umzurüsten. Das kam leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht infrage,[135] obwohl es bereits früher Tests mit neuen Drehgestellen unter ICE-1-Mittelwagen gab.[125]
ICE 1 im Plandienst: 2009 bis 2023
Der ICE 1 verlor im Laufe der folgenden Jahre seine Dominanz. Nach dem ersten Redesign sollen die ÖBB-tauglichen Triebköpfe 401.062–071 sowie 401.562–572 ihre Österreichzulassung verloren haben.[136] Mit der Inbetriebsetzung der ICE-4-Flotte ab 2017 wurden die ICE-1-Einsätze auf der Nord-Süd-Verbindung Hamburg – Fulda – München ausgedünnt.
Am 29.11.2017 kam es zu einer Entgleisung eines ICE 1 im Bahnhof Basel SBB. Drei Wagen, darunter der Speisewagen, wurden durch eine Weichenfehlstellung bei der Einfahrt in den Bahnhof aus der Spur gebracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.[137] Glimpflich ging auch die Entgleisung am 17.02.2019 zwischen Basel Badischer Bahnhof und Basel Bahnhof SBB aus. Eine Weiche verstellte sich bei der Überfahrt eines ICE 1 mit Ziel Interlaken. Der Triebkopf und das erste Drehgestell des ersten Wagens konnten noch das Regelgleis befahren, der restliche Zug befuhr das Nebengleis. Nach etwa einem Kilometer kam die entgleiste Garnitur an zwei nebeneinander liegenden Tunnelportalen zum Stillstand – gerade noch rechtzeitig![138]
Renovierung 2: 2019-2023
Eigentlich sollten die ersten ICE-Züge mittlerweile ausrangiert werden. Doch die hohe Nachfrage erfordert nach wie vor den Einsatz aller Garnituren. Daher entschied sich die Deutsche Bahn, dem ICE 1 erneut ein Redesign zu spendieren. Die DB Systemtechnik und die DB Fahrzeuginstandhaltung führen seit 2020 das große, rund 320 Millionen Euro teure Modernisierungsprojekt aus. Hierbei werden jedoch die schadhaftesten Mittelwagen ausgemustert und dienen als Ersatzteilspender für weniger verschlissene Fahrzeuge. Die Fahrgäste profitieren von zusätzlichen Gepäckregalen und -stellplätzen, neu gestalteten Toiletten, einem verbesserten Fahrgastinformationssystem und einer größeren Barrierefreiheit. In den Triebköpfen werden u.a. neue Sitze montiert. Wegen dieser „Lebens-Dauer-Verlängerung“ werden die nach dem Redesign nur noch neunteiligen Hochgeschwindigkeitszüge als ICE LDV bezeichnet. Sie kommen auf weniger stark ausgelasteten Relationen zum Einsatz: Hamburg – Berlin, Hamburg – Köln, Hamburg – Stralsund, Berlin – Frankfurt, Frankfurt – Dresden, Basel – München und München – Leipzig.[139] Roll-out hatte die erste LDV-Einheit am 25.06.2020. Die Modernisierung soll 2024 abgeschlossen sein.[140][141][142][143][144] Über das 2. Redesign hinaus erhalten 76 Triebköpfe neue, energieeffiziente Stromrichter; 80 Triebköpfe wurden bereits bis 2010 damit umgerüstet.[145]
Umkonfigurationen von ICE-1-Garnituren
Die ICE-1-Züge wurden im Laufe der Jahrzehnte mehrfach umkonfiguriert. Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen innerhalb der ICE-1-Serie aufgeführt. Nach Eschede waren nur noch 59 Garnituren verfügbar. Die Mittelwagen wurden zuerst teils verschrottet, teils zu Übungszwecken genutzt. Letztendlich sind alle Zwischenwagen des ICE 884 dem Altmetall zugeführt worden. Der Triebkopf 401.051 kam wieder in den regulären Dienst – als Ersatz für den im Dezember 2001 ausgebrannten Triebkopf 401.020.[146] Der hintere „Eschede“-Triebkopf 401.551 hielt als Ersatzteilspender her, wurde aber 2007 mit Teilen des ausgebrannten 401.020 zur Wiederaufarbeitung des in Thun verunfallten Triebkopfs 401.573 genutzt.[147][148] Im Frühjahr 2013 waren noch 59 ICE-1-Kompositionen im Einsatz,[133] im März 2016 wurden nur noch 58 einsatzfähige ICE-1-Züge angegeben.[149] Im Juni 2015 hieß es, dass die Reduzierung auf 58 Hochgeschwindigkeitszüge der Serie 401 auf die Zerlegung des Triebzuges 109 (ex-„Aschaffenburg“) zurückzuführen sei, da man sonst für die anderen 58 ICE 1 nicht genügend Wagen zusammenbekommen hätte.[150] Von der Grundkonfiguration der ICE-1-Garnituren Anfang der Neunziger sei durch die flexible Zusammenstellung von Mittelwagen und Triebköpfen nicht mehr viel übrig.[151]
Eine persönliche Sicht auf den ICE 1
Im Sommer 1990 fuhr ich das erste Mal mit einem TGV. Zu erleben, wie der TGV Atlantique zwischen Paris und Le Mans mit 300 km/h durch die Landschaft jagte, sorgte bei mir für Euphorie. Im Juni 1991 musste sich der „nur“ 250 km/h schnelle ICE meinen hohen Erwartungen stellen. Ich war begeistert, wie der Zug nur so vor Komfort strotzte. Der ICE 1 war wirklich ein „prunktvolle[r] Palast auf Rädern“,[26] wie Murray Hughes es in seinem Buch „Die Hochgeschwindigkeitsstory“ passend formulierte. 1995 bewarb ich mich um eine Mitfahrt im Führerstand und bekam eine Zusage. Was mir die von der DB gestellte Begleitperson während der Fahrt nach Kassel-Wilhelmshöhe alles über den Superzug erzählte, vertiefte meine „Liebe“ zur Baureihe 401. Das Sahnehäubchen war eine Führung durch das ICE-Betriebswerk Hamburg-Eidelstedt im gleichen Jahr. Am 3. Juni 1998 brach für mich eine Welt zusammen, als ich die Bilder vom ICE-Unfall in Eschede im Fernsehen sah. „Mein“ ICE 1 riss 101 Menschen aus dem Leben und verursachte so viel Leid. So wurde ab 2000 der neue ICE 3 mein Favorit, in der Hoffnung, dass sich so etwas Schlimmes mit dem neuen Superzug nicht mehr wiederholen würde. Ich freue mich, dass der ICE 1 trotz seiner langen Einsatzzeit immer noch im Dienst steht – dank zweier Modernisierungsmaßnahmen, bei denen aber leider nicht auf luftgefederte Drehgestelle gewechselt wurde. Auch ist der ursprüngliche Komfort beim ersten Redesign meiner Meinung nach, vor allem im Bordrestaurant, abhandengekommen. Aber wie ich des Öfteren höre und lese, bleibt der ICE 1 für viele Fahrgäste auch heute noch die beliebteste Baureihe.
Interne Links zum ICE 1
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | ICE 1 Baureihe 401 Ursprungskonfiguration |
| Einsatzland: | Deutschland tw. Schweiz tw. Österreich |
| Hersteller: | AEG, ABB, Krauss-Maffei, Krupp, Siemens, Thyssen-Henschel (andere Quelle [2]: Thyssen-Henschel, Krauss-Maffei, Krupp, Duewag, LHB, MAN, MBB, Waggon-Union) |
| Herstellungskosten pro Zug: | 25 Mio. Euro |
| Herstellungskosten pro Zug im Detail: | 50 Millionen D-Mark |
| Anzahl der Züge: | 60 Züge |
| Anzahl der Züge im Detail: | 1 Zug nach dem Unfall bei Eschede ausgemustert |
| Anzahl der Triebköpfe: | 2 Triebköpfe |
| Anzahl der Mittelwagen: | 12 Mittelwagen |
| Ursprüngliche Anzahl der Mittelwagen: | 14 Mittelwagen |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | 144 / 501 / 24 (685 insg.) |
| Sitzplätze im Detail: | plus ca. 16 Sitzplätze im Bordbistro |
| Baujahre: | 1989–1993 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 15 kV / 16,7 Hz |
| Zugleitsystem(e): | AFB, Indusi, LZB (Deutschland) |
| Höchstgeschwindigkeit bei Versuchsfahrten: | 328 km/h |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 250 km/h |
| Antriebsleistung des Zuges: | 9.600 kW ( 2 x 4800 kW ) |
| Anfahrzugkraft: | 400 kN |
| Bremssysteme: | Triebkopf: elektr. Nutzbremse Scheibenbremse Mittelwagen: Scheibenbremse Schienenmagnetbremse |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Radtyp: | Monobloc, später auf Radreifen gewechselt, nach ICE-Unfall von Eschede wieder auf Monobloc-Räder zurückgerüstet. |
| Anzahl der Achsen / davon angetrieben: | 56 / 8 |
| Achsformel: | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+ +2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' |
| Federung: | Stahlfederung |
| Länge / Breite / Höhe der Triebköpfe: | 20.560 / 3070 / 3840 mm |
| Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | 26.400 / 3020 / 3840 mm |
| Leergewicht: | 795 t |
| Leergewicht des Zuges im Detail: | Triebköpfe ohne GTO: 80,4 t Triebköpfe mit GTO: 77,5 t Nach Quelle [3]: 792 t Gesamtgewicht |
| Zuglänge: | 357,92 m |
Quellen der technischen Daten:
| |
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | ICE 1 Baureihe 401 (nach 1. Redesign) |
| Einsatzland: | Deutschland, Schweiz |
| Anzahl der Züge: | 58 Züge |
| Anzahl der Züge im Detail: | 1 Triebkopf ausgebrannt, 1 Triebkopf nach Unfall ausrangiert |
| Zugtyp: | Triebzug |
| Anzahl der Triebköpfe: | 2 Triebköpfe |
| Anzahl der Mittelwagen: | 12 Mittelwagen |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | 197 / 506 / 24 (703 insg.) |
| Sitzplätze im Detail: | plus ca. 16 Sitzplätze im Bordbistro |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 280 km/h |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Achsformel: | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+ +2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' |
| Federung: | Stahlfederung |
| Leergewicht: | 782 t |
| Zuglänge: | 358 m |
| Quellen der technischen Daten: „ICE 1 BR 401 – Daten und Fakten“, DB AG, Januar 2019. | |
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | ICE 1 Baureihe 401 (nach 2. Redesign) |
| Einsatzland: | Deutschland |
| Zugtyp: | Triebzug |
| Anzahl der Triebköpfe: | 2 Triebköpfe |
| Anzahl der Mittelwagen: | 9 Mittelwagen |
| Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | 110 / 393 / 24 (503 insg.) |
| Sitzplätze im Detail: | plus ca. 16 Sitzplätze im Bordbistro |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Achsformel: | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+ +2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' |
| Leergewicht: | 627 t |
| Zuglänge: | 279 m |
| Quellen der technischen Daten: „ICE 1 BR 401 modernisiert – Daten und Fakten“, DB AG, Januar 2023. | |
Quellenangaben
- „Bundesverkehrsminister Dr. Werner Dollinger zum ICE“ in: „ICE Zug der Zukunft“, Hestra-Verlag, Darmstadt, 1985, S. 9.
- „Dr.-Ing. Reiner Gohlke, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bundesbahn“ in: „ICE Zug der Zukunft“, Hestra-Verlag, Darmstadt, 1985, S. 11.
- „Am 2. Juni startet die Bahn das Unternehmen Zukunft“, Broschüre der Deutschen Bahn zur Inbetriebnahme des ICE-Verkehrs in Deutschland, 1991.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 20.
- ICE – Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn AG“ in: Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr in Europa und Japan. Superzüge in Europa und Japan“, Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, 1994, S. 120–122.
- „Der ICE kommt“, Eisenbahn Magazin, 11/1989, S. 14-15
- „ICE – Der deutsche Superzug“, VHS-Film, ab Min. 00:09:30.
- „ICE 1 – die Bestellung und der Bau“, ICE-Fansite von Claudia Franke, abgerufen am 08.10.2022.
- „ICE-Testfahrten bis 280 km/h“, Eisenbahn Magazin, 8/1990, S. 6.
- „DB Magazin 1991“, Deutsche Bundesbahn, Abt. Foto-Film-Video, Rhabanusstraße 3, 6500 Mainz 1.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 187.
- „ICE“, 52-seitige Broschüre zur Betriebsaufnahme des ICE-Verkehrs 1991; Deutsche Bundesbahn, Zentrale, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Friedrich-Ebert-Anlage 43–45, 6000 Frankfurt am Main.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 87.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 135–137.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 188.
- Wolfgang Klee: „Die ICE-Familie“, Eisenbahn Journal Special 5/99, S. 28.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 96–97.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 90.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 89.
- Dr. Helmut Petrovitsch: „Das Shinkansen-Hochgeschwindigkeits-Netz in Japan“, Eisenbahn-Revue International, 7/2002, S. 328.
- „20 Jahre InterCityExpress“, Bahn Extra, 6/2004, S. 42.
- Heinz R. Kurz: „Der InterCity Expreß (ICE) – ein Zugsystem für Europa“, Verlag und Erscheinungsjahr unbekannt, S. 10.
- „‚Gummireifen‘ für das ICE-Bordrestaurant“, Eisenbahn Magazin 6/92, S. 7.
- „Die ICE-Tragödie von Eschede“, Eisenbahn-Revue International, 7–8/1998, S. 333–335.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 138.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 184.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 128–133.
- „ICE Triebköpfe und Mittelwagen“, Fernverkehrsseiten von Marcus Grahnert, Website abgerufen am 31.03.2005.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 185.
- „Rauchverbot in Bordbistros der Bahn“, Yahoo Deutschland Nachrichten, 09.07.2006.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 136–137.
- „Der Tunnel“, Eisenbahn Magazin, 6/94, S. 7.
- Wolfgang Klee: „Die ICE-Familie“, Eisenbahn Journal Special 5/99, S. 46.
- „ICE“, Bahn Special 9703, Geranova Zeitschriftenverlag München, S. 23.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 90–91.
- Wolfgang Klee: „Die ICE-Familie“, Eisenbahn Journal Special 5/99, S. 22–25.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 123–125.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 30.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 34.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 31–32.
- „Den Riss früher entdecken“, Süddeutsche Zeitung, 27.02.2001.
- „Logistik für Instandhaltung und Behandlung – der Werkbetrieb“, Technologie der Zukunft, ICE-Betriebswerk Hamburg, Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Hamburg.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 29.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 125–127.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 30.
- Murray Hughes: „Die Hochgeschwindigkeitsstory – Eisenbahnen auf Rekordfahrten“, Alba Publikation AIF Teloeken GmbH + Co. KG, Düsseldorf, 1994, S. 186.
- „20 Jahre InterCityExpress“, Bahn Extra, 6/2004, S. 42.
- „Aerodynamik auf Schienen“, Eisenbahn Magazin, 6/92, S. 18.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 88.
- Michael Dörflinger, Claudia Franke: „Typenatlas ICE: Technik – Geschichte – Einsatz“, Geramond-Verlag, 2014, S. 32.
- „High Tech in Eidelstedt“, Eisenbahn Magazin, 6/91, S. 12–15.
- „Maschinentechnische Systeme – das aufgeständerte Gleis“, Technologie der Zukunft, ICE-Betriebswerk Hamburg, Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Hamburg.
- „Instandhaltung und Behandlung von ICE-Zügen“, Technologie der Zukunft, ICE-Betriebswerk Hamburg, Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Hamburg.
- Horst J. Obermayer: „Internationaler Schnellverkehr – Superzüge in Europa und Japan“, Franck-Kosmos Verlags-GmbH + Co., Stuttgart, 1994, S. 133–135.
- „20 Jahre InterCityExpress“, Bahn Extra, 6/2004, S. 36–38.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 35.
- „ICE nach Amerika verschifft“, Eisenbahn Magazin, 8/93, S. 7.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 40.
- „Hoffnungslauf des Eis-Train“, Eisenbahn Magazin, 12/93, S. 16–19.
- „ICE“, Bahn Special 9703, Geranova Zeitschriftenverlag München, S. 4–5.
- „ICE“, Bahn Special 9703, Geranova Zeitschriftenverlag München, S. 12.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 23.
- „Halbzeit-Erneuerung für den ICE 1“, Eisenbahn Revue International, 7/2005, S. 321.
- Georg Wagner: „InterCityExpress − Die Starzüge im Fernverkehr der DB“, EK-Verlag Freiburg, 2006, S. 6–9.
- „ICE in Österreich“, Eisenbahn-Revue International, 7–8/1998, S. 282–283.
- „ICE-S“, Ausdruck einer nicht mehr existierenden Webseite von 2000.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 51.
- Hans Leyendecker: „Deutsche Perfektion – nur in der Theorie“, Süddeutsche Zeitung, 21.05.1999.
- Hartwig von Saß: „Die ICE-Katastrophe dauerte 13 Sekunden“, Die Tagespost, 24.08.2002.
- Hans Leyendecker: „Dreigleisige Ermittlungen“, Süddeutsche Zeitung, 16.01.1999.
- Hubert Filser, Jeanne Rubner: „Wellengang auf Schienen“, Süddeutsche Zeitung, 25.06.1998.
- Holger Klasmeier, Ingenieur für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Transportation Systems, Thales, Website abgerufen am 26.07.2023.
- „Opfer des Profits – Deutsche Bahnprivatisierung fordert grausigen Tribut“, World Socialist Web Site, 01.07.1998.
- „Eschede wäre vielleicht vermeidbar gewesen“, N24 Recherche, 15.08.2001.
- „Kontrollsystem von ICE-Rädern hatte Mängel – Zweite Zusammenfassung“, Yahoo Nachrichten, 29.08.2002.
- „ICE-Unglück in Eschede: Eine Katastrophe und ihre Folgen“, NDR.de, 03.06.2023.
- „Fahrt in den Tod“, National Geographic, Filmdokumentation, Erscheinungsjahr unbekannt, ab Minute 04:30.
- „Heimsuchung im High-Tech-Land“, Der Spiegel, 07.06.1998.
- Heinz Betzler: „Veraltete Weichentechnik gefährdet den ICE“, ProBahn Zeitung, 03/1999, S. 31.
- „Sekunden vor dem Unglück“, National Geographic, Filmdokumentation, Erscheinungsjahr unbekannt.
- Jan-Erik Hegemann: „Die ICE-Katastrophe von Eschede: Der Einsatz“, Feuerwehr Magazin, September 1998, S. 32–41.
- „Halbzeit-Erneuerung für den ICE 1“, Eisenbahn-Revue International, 7/2005, S. 320.
- Christoph Drösser, Bernd Loppow: „Das Rad noch mal erfinden!“, Die Zeit, 25/1998.
- B. Meyer: „Der Weg in die Katastrophe“, Texthalde, 06/1999, letzte Änderung: 26.11.2001.
- „Kontrollsystem bei ICE-Rädern war mangelhaft – Erste Zusammenfassung“, Yahoo Schlagzeilen, 29.08.2002.
- „Zuviel Vertrauen in die Bahn“, Süddeutsche Zeitung, 19.06.1998.
- Wurde dem Verfasser zugemailt.
- „Fahrgäste als Testpersonen?“, Leserkommentar, Süddeutsche Zeitung, 10.05.1999.
- „Neues Sicherheitskonzept“, Eisenbahn-Revue International, 7–8/1999, S. 282.
- „Den Riss früher entdecken“, Süddeutsche Zeitung, 27.02.2001.
- „Reise-Visionen“, como 05, September 2010, S. 25.
- C. Duismann: „Neues Konzept bei der Bahn soll Wiederholung des Eschede-Unglücks verhindern“, Pressenotiz, 04.05.1999.
- „Opferanwalt kritisiert Prozess um Eschede-Unglück“, Die Welt, AP, 28.08.2002.
- „Eschede – Die Todesfahrt“, Filmdokumentation, Phönix/NDR, 2006, ab Minute 21:15.
- „Sekunden vor dem Unglück“, National Geographic / N-TV, Filmdokumentation, ab Minute 46:20.
- „Eschede – Zug 884“, Filmdokumentation vom NDR, 2008.
- „ICE 1-Ersatzverkehr beendet“, Eisenbahn Magazin 12/98, S. 7.
- „Neues Sicherheitskonzept“, Eisenbahn-Revue International, 7–8/1999, S. 282.
- Stefan Gärditz: „‚Entgleisung‘ im Schönraintunnel“, Mainpost, 06.07.1998.
- „Rette sich wer kann!“, Eisenbahn-Kurier 10/2002, S. 55–56.
- „Bahn gelobt Besserung nach ICE-Pannenserie“, Yahoo Schlagzeilen, 06.10.2000.
- „ICE wegen starker Rauchentwicklung im Tunnel gestoppt“, Yahoo Schlagzeilen, 23.04.2001.
- „Nachbesserung“, Mainpost, eine Ausgabe von April 2000.
- „Schäden an ICE-1-Triebköpfen“, Eisenbahn Magazin, 05/00, S. 8.
- „ICE-1-Triebkopf ausgebrannt“, Eisenbahn-Kurier, 2/2003, S. 72.
- Marc Dahlbeck: „ICE: Geschichte – Technik – Einsatz“, transpress Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2022, S. 98, 101.
- „Hannover – Rasender ICE gibt Experten Rätsel auf …“, Yahoo Schlagzeilen, 19.11.2001.
- „Zu schneller ICE kein Einzelfall – ähnliche Panne schon im Juni“, Yahoo Finanzen, 25.11.2001.
- „‚Der Schutzengel ist mitgefahren‘“, Tagesanzeiger.ch, 28.04.2006.
- „Kollision eines ICE mit zwei BLS-Lokomotiven in Thun“, Eisenbahn-Revue International, 6/2006, S. 286–289.
- „ICE entgleist in Tunnel“, N-TV, 27.04.2008.
- „Triebkopf des Unglückszuges geborgen“, Tagesschau.de, 29.04.2008.
- „Nach ICE-Unfall: Kritik an Krisenreaktion der Bahn“, Mainpost, 06.05.2008.
- „Leistungsfähigkeit ‚sehr begrenzt‘“, Feuerwehr Würzburg – Abschnitt Mitte, 19.11.2008.
- Zeno Pillmann: „Der Schnelltriebzug der Baureihe 403/403 der Deutschen Bundesbahn“, Eisenbahn-Revue International, 5/1999, S. 220–223.
- „Lufthansa tritt Strecken an die Bahn ab“, Die Welt, 14.07.1998.
- „Kooperation: Fliegen auf ‚Höhe Null‘“, Deutsche Bahn Pressemitteilung, 10.03.2001.
- „Zug zum Flug“, Eisenbahn-Revue International, 4/2001, S. 147.
- Sabine Siebold: „Lufthansa will mehr Passagiere auf ICE-Routen holen“, Yahoo Schlagzeilen, 23.07.2002.
- „Schweiz finanziert ETCS für den ICE“, Eisenbahn Magazin 10/2005.
- „Schweiz rüstet deutsche Züge mit ETCS aus“, Eisenbahn-Revue International, 10/2005, S. 483.
- „ÖBB weihen ihren ersten ICE ein: Kooperation mit Deutscher Bahn“, Der Standard, 10.12.2006.
- „ÖBB: Mehr als fünf Millionen Fahrgäste mit dem ICE“, Travel Management Austria, 10.04.2014.
- „ICE – Superzug mit Schattenseiten“, Bahn-Extra 04/2013, Juli/August, S. 52.
- „20 Jahre InterCityExpress“, Bahn Extra, 6/2004, S. 43.
- Gerhard Bläske: „Aus für den ‚Airbus der Schiene‘“, Süddeutsche Zeitung, 18.10.2004.
- Eberhard Krummheuer: „Bahn verlängert Leben der 15 Jahre alten ICE 1“, Handelsblatt, 17.01.2005.
- Walter Wille: „Dreimal bis zur Sonne“, FAZ.net, 20.06.2005.
- „400 Millionen Zugkilometer bei der ICE-1-Flotte erreicht“, Deutsche Bahn AG Presseinformation, 30.08.2005.
- „ICE 1: Schöne neue Speisewagen-Welt?“, Eisenbahn Magazin 10/2005, S. 8.
- Olaf Krohn: „Ein Puzzle mit 12 000 Teilen“, bahn REPORT 09/2005, S. 36–38.
- „Der erste ICE 1 aus Redesign fährt“, Eisenbahn-Revue International, 10/2005, S. 467.
- „ICE – Superzug mit Schattenseiten“, Bahn-Extra 04/2013, Juli/August, S. 14.
- „ICE 1 modernisiert“, Eisenbahn-Revue International, 4/2007, S. 158.
- „Halbzeit-Erneuerung“, Eisenbahn-Revue International, 7/2005, S. 320–321.
- „401er mit Österreich Zulassung“, Thread auf ice-treff.de, gepostet von Axel252525, 31.08.2018.
- „ICE in Basel entgleist“, BAZ Online, 29.11.2017.
- „ICE-Entgleisung in Basel mit glimpflichem Ausgang“, Eisenbahn-Revue International, 4/2019, S. 194–198.
- „Die 1. ICE werden noch länger unterwegs sein | Der modernisierte ICE 1 im Detail“, Eisenbahn in Ö, D, CH, Youtube-Video abgerufen am 28.07.2023.
- „DB Fernverkehr: Erster verkürzter ICE 1 im Planeinsatz“, Eurailpress, 30.06.2020.
- „Modernisierung des ICE 1 für den Betrieb bis 2030“, DB Systemtechnik Website, Mai 2020.
- Eberhard Krummheuer: „Läuft und läuft und läuft“, Frankfurter Allgemeine, 07.06.2020.
- „Modernisierung des ICE 1 für den Betrieb bis 2030“, DB-Systemtechnik München, Mai 2020.
- „Lebensdauerverlängerung ICE 1“, Elektrische Bahnen Website eb-info.eu. 13.10.2022.
- „76 Triebköpfe der ICE 1-Flotte erhalten neue Stromrichter“, Bahnblogstelle, 22.09.2022.
- Konrad Koschinski: „Die ICE-Story“, Eisenbahn Journal Extra 1, 1/2005, S. 36.
- „ICE – Superzug mit Schattenseiten“, Bahn-Extra 04/2013, Juli/August, S. 69.
- Michael Dörflinger, Claudia Franke: „Typenatlas ICE: Technik – Geschichte – Einsatz“, Geramond-Verlag, 2014, S. 27.
- „Die DB-Flotte“, DB mobil, Ausgabe 3/2016, S. 96.
- Marien: „ICE 1“ in: „Reihungen ICE 1“, ICE-Treff.de, 22.06.2015.
- Weiler: „Flexibilität mit ICE 1-Triebzügen“, ICE-Treff.de, 09.01.2013.












